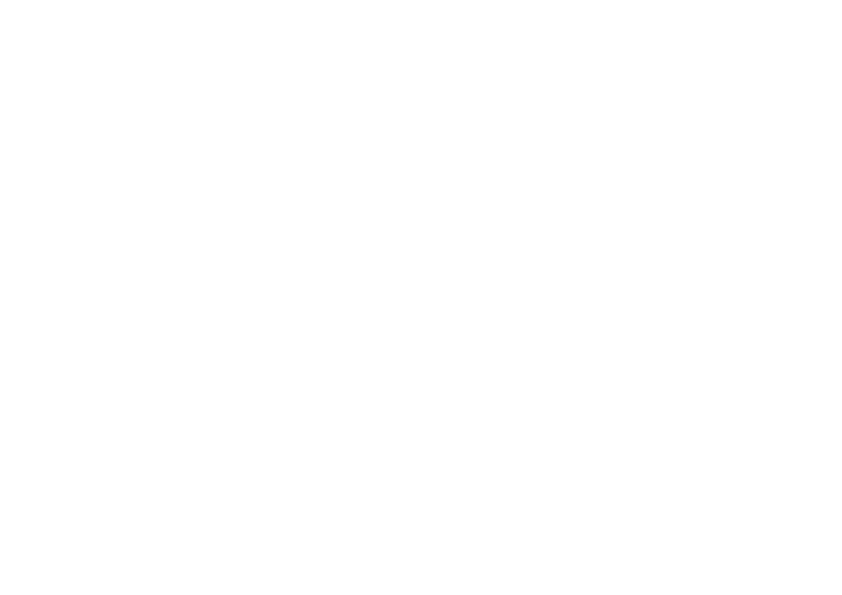– „Adieu“, sagte er.
– „Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier mein Geheimnis. Es ist sehr einfach: Man sieht nur mit dem Herzen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
– „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, wiederholte der kleine Prinz, um sich daran zu erinnern.
– „Es ist die Zeit, die du für deine Rose geopfert hast, die sie so bedeutsam macht.“
– „Es ist die Zeit, die ich für meine Rose geopfert habe, die sie so bedeutsam macht“, sagte der kleine Prinz, um sich daran zu erinnern.
– „Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen“, sagte der Fuchs.
Aber du sollst sie nicht vergessen. Du wirst immer verantwortlich sein für das, was du zähmst. Du bist verantwortlich für deine Rose …“
– „Ich bin verantwortlich für meine Rose“, wiederholte der kleine Prinz, um sich daran zu erinnern.“
So etwas Ähnliches passiert auch in der Ersten der beiden Geschichten im zweiten der insgesamt fünf aktuellen digitalen Sonderangebote dieses Newsletters, die wie immer eine Woche lang zum Sonderpreis im E-Book-Shop www.edition-digital.de (Freitag, 07.04.23 – Freitag, 14. 04. 23) zu haben sind. Sie heißt „Der fremde Vogel“ und spielt in … Nein, das wollen wir hier noch nicht verraten. Das würde die Spannung zu früh verringern. Spannungen im Sinne von Konflikten gibt es dagegen in der zweiten Tiergeschichte dieses Buches „Wie die Tiere einen Richter wählen wollten“: Viele Jahre lebten die Tiere des Waldes in Frieden miteinander, bis …
Eine Art Mutprobe soll Peter in „Beenschäfer“ von Kurt David bestehen, eine ziemlich unmoralische Mutprobe allerdings.
Was so alles passieren kann, wenn man (in diesem Falle heißt der kleine Mann übrigens Till) Post aus der Sowjetunion bekommt, das erzählt Reinhard Bernhof in „Die Kürbiskernkopeke“.
Vom selben Autor stammt auch „Als die Pappel zur Sonne wuchs“. Darin findet es ein namenloser Junge, der einfach immer nur der Junge genannt wird, total blöd, dass es die ganzen Sommerferien über nur regnet und regnet. Und der Junge denkt, dass er etwas dagegen unternehmen muss …
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Die Handlung des heutigen Buches spielt im vorletzten Kriegsjahr in Frankreich. Es geht um einen Deutschen in Uniform, um eine hübsche junge Französin und um überlebenswichtige Entscheidungen, die Krieg und Frieden betreffen. Ein Krieg hört nicht einfach von selbst auf, und der Frieden kommt nicht von allein wieder in die Welt. Aktives Handeln ist gefragt – Friedenskampf, wenn man so will …
Erstmals 1959 erschien als Heft 35 der Erzählerreihe des Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung Berlin „Zwei Uhr am roten Turm“ von Kurt David: Frankreich 1944: Unteroffizier Kahlbaum hat den Auftrag, Madeleine, die hübsche Tochter des Gastwirts, zu bespitzeln, denn die Deutschen vermuten, dass sie im Widerstand aktiv ist. Doch Madeleine gelingt es immer wieder, Kahlbaum zu entwischen. Als die Untergrundorganisation einen Anschlag auf den deutschen Stützpunkt vorbereitet hat, warnt Madeleine den Gefreiten Hans Eiselt und fordert ihn auf, sich für eine Seite zu entscheiden. Eiselt hatte ihr wichtige Informationen über den Stützpunkt geliefert und ist jetzt in Gefahr. Doch Kahlbaum entdeckt und belauscht die beiden und verhaftet sie. Ist jetzt alles aus?
Gleich zu Beginn des spannenden Buch treffen wir Kahlbaum, Unteroffizier Kahlbaum, und Madeleine, bei der er aber offenbar nicht landen kann:
„1
Kahlbaum fläzte sich an einem großen, runden Tisch, der mit gelbbraunem Linoleum ausgelegt war. An fünf anderen saßen Franzosen, redeten und rauchten, lachten und tranken. Da er ihre Sprache nicht verstand und zudem noch in der trüben Eigenschaft eines Spitzels in der kleinen Gaststube lauerte, hatte er das Gefühl, als lachten und redeten sie über ihn. Das Lachen traf ihn wie Schläge, und das Reden erweckte bei ihm den Eindruck, als besprächen sie, was gegen ihn zu tun sei.
Auf seinem Tisch, an dem vorher drei Franzosen gesessen hatten, die aber, nachdem er sich zu ihnen gesetzt hatte, aufgestanden und zu einem anderen Tisch gegangen waren, glänzten kleine Weinlachen im gelben Lampenlicht, Pfützen verschütteten Rotweines. Er wusste, dass die Franzosen, die zahlreich an den übrigen Tischen hockten, jetzt alle nacheinander ihre Zeche bezahlen und weggehen würden. Das war hier in Précipice immer so gewesen: Kam ein Grauer, gingen die Franzosen; ein lautloser Widerstand gegen jene Deutschen, die Kahlbaum repräsentierte.
Trotz der Kaltschnäuzigkeit, die ihm eigen war, wurde er ein wenig verlegen. Er hatte sein abgebranntes Streichholz in der Hand, fuhr damit in den Pfützen herum, zweigte kleine Kanäle ab und verband Lache mit Lache. Wie Blut sahen diese kleinen Weinpfützen aus, wie Blutflecke auf einem mit gelbbraunem Linoleum ausgelegten Tisch.
Blickte er auf, und das geschah recht oft, sah er hinüber zum Schanktisch. Dort saß Madeleine. Das schwarzhaarige französische Mädchen war die Tochter des Besitzers dieser Gaststube, der jetzt von Tisch zu Tisch schlurfte und kassierte. Madeleine hatte fünf Semester Philologie studiert und saß hinter dem Schanktisch, weil im Jahre neunzehnhundertvierundvierzig nicht mehr studiert werden konnte.
Unteroffizier Kahlbaum sah nur ihren Kopf und die Brust sowie das Bewegen der Oberarme. Er hörte das leise Klickern und Tickern der Stricknadeln, wenn sie zusammenstießen. Das Strickzeug sah er nicht. Manchmal schaute sie auf, blickte jedoch nie zu ihm, sondern zu irgendeinem Franzosen, lächelte ihm zu. Ihr Vater strich das Geld von den runden Tischen.
Madeleine war ein hübsches Mädchen. Das gestand sich auch Kahlbaum, doch immer, wenn sie ihn missachtete, wenn sie tat, als sei er noch nicht einmal soviel wie der blaue Zigarettenrauch in der kleinen Weinstube, wurde er sich seiner Aufgabe voll bewusst und dachte grimmig: Warte, du wirst schon noch klein, winzig klein! Dich krieg’ ich! Du ahnst ja nicht, dass ich deinetwegen hier bin. Und heut entkommst du mir nicht, das sage ich dir. So schlau wie ihr bin ich schon lange!
Er hatte sich so auf den Stuhl gesetzt, dass er den Lauf seines Gewehres, das über der Lehne hing, am Oberarm spürte. Neunzehnhundertvierundvierzig war der Ausgang nur noch mit Gewehr gestattet. Die Kontrolle durch den Oberarm schien ihm geboten, weil er fürchtete, die Franzosen könnten ihm die Waffe stehlen. Solche Dinge hatten sie schon öfter vollbracht.
Die ersten Franzosen verließen den Raum. Kahlbaum guckte auf seine Armbanduhr. Einundzwanzig Uhr. Bald wird sie wieder abflitzen, die kleine Schwarze. Aber wie gestern und vorgestern kommt sie nicht davon, dachte er. Da war es nämlich so gewesen, dass er erst gezahlt hatte, als sie schon verschwunden war. Und das hatte geraume Zeit in Anspruch genommen, denn der Alte stellte sich jedes Mal taub, verzögerte die Zahlung bewusst. Dadurch hatte Kahlbaum immer den Anschluss verloren. Zweimal hatte er draußen gewartet, sich versteckt, aber an diesen Tagen war sie nicht weggegangen. Er teilte mit Oberleutnant Krätzig die Ansicht, dass diese Madeleine einer Widerstandsgruppe angehöre, zu der sie die Verbindung halte. „Beobachten Sie mal ein bisschen die Kleine“, hatte der Oberleutnant gesagt, „ich hab’ nicht Lust, mir von der eines Tages in die Suppe spucken zu lassen!“
Aus diesem Grunde nahm Unteroffizier Kahlbaum an diesem Abend das Geld bereits abgezählt aus der Tasche, hielt es in der geschlossenen Faust. Sobald sie geht, lege ich die Piepen auf den Tisch, mache ihr nach, und der Alte ist ausgeschaltet.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Erstmals 1964 veröffentlichte Kurt David im Kinderbuchverlag Berlin seinen für Leserinnen und Leser von sechs Jahren an gedachten „Beenschäfer“ – als Band 45 der bekannten und beliebten Reihe „Die kleinen Trompeterbücher“: Peter ärgert sich wieder einmal auf dem Rodelberg über die großen Jungen. Peterchen oder Peterlein rufen sie ihn. Dabei ist er mutig, er rodelt sogar den Steinbruch runter. Doch das erkennen die Jungen nicht an, es sei denn, er ruft Herrn Schäfer mit dem steifen Bein ganz laut „Humpelheinrich“.
Die Erwachsenen nennen ihn Beenschäfer, aber nur, um ihn von den anderen Schäfers im Dorf zu unterscheiden. Beenschäfer ist ein freundlicher alter Mann, der freiwillig Bäume gepflanzt hat und sie pflegt. Er wohnt gleich neben Peter und ausgerechnet ihn soll er so ärgern!
Schließlich ruft er das Schimpfwort zweimal und kann sich gar nicht freuen. Nun versucht er dem alten Mann aus dem Weg zu gehen, aber einmal gelingt es ihm nicht. Und so beginnt diese nachdenklich stimmende Geschichte:
„Beenschäfer
Die Geschichte erzählt von einem alten Mann und einem kleinen Jungen. Beide wohnen in einem Dörfchen der Oberlausitz.
Der alte Mann heißt Heinrich Schäfer.
Der kleine Junge Peter.
Es gibt aber drei Familien mit dem Namen Schäfer im Dorf.
Um sie besser auseinanderhalten zu können, gaben die Einwohner den drei Schäfers schon vor vielen Jahren treffende Beinamen.
So heißen die einen Pappelschäfer, weil eine hohe Pappel vor ihrem Hause steht, die anderen Bornschäfer, weil der einzige Brunnen in ihrem Garten liegt, und zu unserem Heinrich Schäfer, dem alten Mann, sagen sie Beenschäfer, weil er ein steifes Bein hat.
Beenschäfer wohnt im gegenüberliegenden Hause von Peter.
Es war Winter.
Die Kinder freuten sich, freuten sich über den vielen, vielen Schnee. Die Erwachsenen seufzten unter der grimmigen Kälte.
Der Frost biss um sich, färbte die Gesichter rot. Und rot glühte auch die Sonne, wenn sie morgens aus dem verschneiten Walde stieg. Eine glitzernde Schneedecke ruhte auf Häusern und Feldern, Gärten und Wegen. Aus Schornsteinen wehten schmutzige Rauchsträhnen.
An solch einem Morgen trat Peter aus der Haustür und ließ den kleinen Schlitten die Stufen hinunterhopsen. Tripp – trapp – trupp, unten war er und bumste gegen das Gartentor.
In diesem Augenblick trat aber auch Beenschäfer aus seinem Haus. Ebenfalls mit einem Schlitten.
Nanu, dachte Peter, will der alte Mann vielleicht auch Schlitten fahren? Peter lächelte. Das geht doch gar nicht, dachte er, das kann ja gar nicht gehen. Beenschäfer hat ein steifes Bein. Und Opas fahren überhaupt nie Schlitten. Wie würde das bloß aussehen, wenn der Alte mit seinem Schnauzbart auf dem Schlitten den Rebhuhnhügel hinunterführe. Alle würden lachen.
Heinrich Schäfer lud einen prallen Sack auf. Danach zündete er sich seine Hängepfeife an, blies den Rauch hoch in die Luft. Der feine Rauch war so blau wie der blanke Winterhimmel.
Peter nahm seinen Schlitten und zog ihn über den Schnee.
Beenschäfer nahm auch seinen Schlitten und zog ihn über den Schnee.
Beide fuhren auf ein und demselben Weg, wenn auch weit voneinander entfernt.
Der schmale Weg führt hinaus ins offene Feld. Und der Weg gehört zur Genossenschaft. Die Genossenschaft trägt einen schönen Namen. Sie heißt: „Goldene Ähre“. Aber das sagt keiner. Würde jemand Peter fragen, wo er wohne, so erwiderte er bestimmt: „Neben der Drei!“ Alle Leute im Ort sprechen von der „Drei“. Niemand sagt: „Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Goldene Ähre.“ Das ist den Leuten zu umständlich. Sie sagen: „Ich arbeite auf der Drei.“ Und „Drei“ heißt die Genossenschaft, weil sie vom Typ III ist.
Peter hatte den Schweinestall erreicht. Hinter dem Schweinestall dehnte sich das weite Feld, erhoben sich die Hügel, leuchtete fern der Winterwald. Peter sah schon die Kinder auf dem Rebhuhnhügel. Dorthin wollte er mit seinem Schlitten. Er drehte sich um und blickte zurück ins Dorf. Wirklich, der alte Schäfer kam denselben Weg heraus. Ich möchte wissen, wo er mit dem großen Sack hin will, dachte Peter.“
Erstmals 1987 erschien im Kinderbuchverlag in der bekannten und beliebten Reihe „Die kleinen Trompeterbücher“ als Band 182 „Der fremde Vogel“ von Hans-Peter David – gedacht für junge Leserinnen und Leser von sieben Jahren an. „Der fremde Vogel“ ist das einzige Buch des Autors geblieben, der nach seinem Studium der Innenarchitektur als Filmarchitekt bei der DEFA gearbeitet hatte, Mitte der 1980er Jahre invalidisiert worden war und 1991 nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 42 Jahren gestorben ist.
Die Geschichte vom fremden Vogel beginnt mit einer alten Frau, die dem Erzähler einen kleinen Vogel zeigt und ihn fragt, ob er ihn behalten wolle. Die Frau hatte den Vogel drüben im Wald unter einem Baum gefunden, wahrscheinlich war er aus dem Nest gefallen. Was soll er tun? Was kann er tun. Kann er den fremden kleinen Vogel retten?
In der zweiten Tiergeschichte „Wie die Tiere einen Richter wählen wollten“ geht es darum, dass der Frieden unter den Tieren des Waldes gestört ist. Es gibt Streit. Oder genauer formuliert: Zwei Igel hatten einen heftigen Streit miteinander und blickten sich zornig an. Und der Bär sagt: „Ihr seht, jeder hat seine Meinung zu diesem schwierigen Fall, und jeder hat, wie es scheint, auf seine Weise recht. Doch müssen wir eine Lösung finden, die den Kern der Sache trifft. Darum lasst uns einen Richter wählen, der über Recht und Unrecht entscheidet!“ Aber wer soll dieser Richter sein? Auch das ist eine schwierige Sache. Aber zurück zum fremden Vogel:
Hier der Anfang der berührenden Geschichte vom Mischelow. Mischelow? Was soll das denn sein? Um das herauszufinden, muss man einfach nur etwas Bulgarisch können? Womit zugleich der Schauplatz dieser Geschichte beschrieben ist:
„Der fremde Vogel
Keiner beachtete die alte Frau, als sie sich auf dem Weg, der am Kloster vorbeiführte, unserer Gruppe näherte. Ich stand ein wenig abseits, bestimmt wandte sie sich deshalb an mich. Sie streckte mir ein zum Bündel gewickeltes Kopftuch entgegen und sagte einige Worte auf Bulgarisch, die ich nicht verstehen konnte: nur das dreimal wiederholte „Mischelow“ fiel mir auf. Ich schlug die Zipfel des Tuches zurück und sah einen jungen Vogel in die plötzliche Helligkeit blinzeln.
Gerade verkündete der Regisseur, dass die Einstellung „gestorben“ sei, und der Kameramann ergänzte, es sei für weitere Aufnahmen bereits zu dunkel. Um mir die Worte der alten Frau übersetzen zu lassen, holte ich die Dolmetscherin. Beide sprachen miteinander, und ich erfuhr folgenden Sachverhalt:
Die Frau hatte den Vogel drüben im Wald unter einem Baum gefunden, wahrscheinlich war er aus dem Nest gefallen. Sie fragte, ob ich ihn behalten wolle. Ich antwortete nicht, sondern sagte: „Was heißt Mischelow?“
„Bussard, Mischelow heißt Bussard.“
Inzwischen waren einige Kollegen herangetreten und bestaunten den Vogel, den nun ich in den Händen hielt. Einer steckte mir ein Brötchen zu. Ich setzte den Bussard auf die verwitterte Bank und versuchte, zur Kugel geformte Brötchenkrume in seinen Schnabel zu stecken, nicht wissend, was ein Bussard frisst.
Der Aufnahmeleiter kam und forderte alle auf, in die Fahrzeuge zu steigen.
Nicht weit von der Bank lehnte sich ein alter, erfrorener Baum so schräg gegen zwei jüngere Bäume, dass ich ihn, in der einen Hand den Vogel, mich mit der anderen abstützend, erklimmen konnte. Ich setzte den Kleinen auf einen dicken, verdorrten Ast, kletterte wieder hinunter und lief zu dem Bus, wo die Kollegen schon warteten.
„Den holen die Katzen“, sagte der Fahrer, „hättest drauflatschen sollen, das wäre leichter für ihn“.
Die Kollegen stimmten ihm nicht zu, aber eine bessere Lösung wusste keiner.“
Erstmals 1982 veröffentlichte Reinhard Bernhof ebenfalls im Kinderbuchverlag Berlin „Die Kürbiskernkopeke“ – wiederum gedacht für junge Leserinnen und Leser ab sechs Jahren: Till bekommt von Nina aus der Sowjetunion einen Brief mit einem Kürbiskern. Darauf steht eine 1, als wäre es eine Kopeke. Er steckt den Kern in den Komposthaufen im Garten seiner Oma und erntet einen riesengroßen Kürbis, den er am nächsten Tag in die Schule mitnehmen will. Aber wie soll er ihn nach Hause bringen? Der Bus ist vollbesetzt, da passt er mit der großen Kugel nicht rein. Schließlich rollt er den Kürbis den Berg hinunter. Aber gehen wir erst mal ein Stück zurück, also zeitlich gesehen:
„Die Kürbiskernkopeke
Till hat seinen ersten Brief bekommen. Er erkennt die Handschrift seines Vaters. Bunte Briefmarken kleben auf dem Umschlag. Auf der einen ist ein blau-rotes Flugzeug zu sehen, es fliegt über goldene Zwiebeltürme. Auf den anderen Briefmarken sind Kosmonauten abgebildet. Vorsichtig öffnet Till den Brief mit einem spitzen Bleistift. Da fällt etwas Weißes aus dem Briefpapier. Wie ein Knopf sieht es aus. Till hebt es auf und wundert sich. Die Zahl 1 ist mit grüner Tinte draufgemalt. Das ist doch ein Kürbiskern, denkt Till. Was soll bloß die Zahl darauf bedeuten?
Er steckt den Kürbiskern erst einmal in die Hosentasche und liest Vaters Brief. In Gedanken ist er mit ihm auf der Baustelle im fernen Tbilissi und stellt Maschinen auf. Vater schreibt auch von Oleg und seiner Familie, bei der er schon zu Besuch war, und er schreibt von Nina.
Von ihr stammt also der Kürbiskern. Nina hat viele Kürbiskerne geröstet. Sie hat sie wie Nüsse gegessen. Die zehn größten hat sie nicht geröstet. Zahlen von 1 bis 10 malte sie darauf und spielte mit ihnen wie mit Kopeken. Eine Kürbiskernkopeke hat sie Tills Vater gegeben, ein Gruß von Nina an Till.
Am Nachmittag schreibt Till Zahlen, kaut am Bleistiftende und überlegt, was man alles mit einem Kürbiskern machen kann – mit so einer Kürbiskernkopeke. Man könnte im Spielzeugkaufmannsladen einkaufen. – Ihm wird schon noch was Besseres einfallen. Jawohl, er wird in Omas Garten gehen. Sie wohnt im Nachbarort. Dort wird er einen Kürbis großziehen. Natürlich mit Omas Hilfe.
Ein Jahr ist vergangen. Vater war inzwischen zweimal zu Besuch. Er erzählte von der schönen Stadt Tbilissi, wo es immer schon zwei Stunden später ist als hier. Auch wärmer ist es dort. Und von Teeplantagen sprach er. Der Mutter brachte er eine buntbestickte Wärmemütze für die Teekanne mit. So wusste Till bald mehr als alle anderen in seiner Klasse über die Sowjetunion zu erzählen. Und immer wieder sprach er von Nina. Sie ist in die Schule gekommen und trägt ein rotes Halstuch. Tausendmal schon hat sie sich nach Till erkundigt – und was aus ihrer Kürbiskernkopeke geworden ist.
Der August und der September sind in diesem Jahr besonders warm. Die Sonne scheint täglich, bis auf ein paar schwüle Gewittertage.
Fast jedes Wochenende fährt Till auf seinen Rollschuhen die breite Teerstraße entlang zu seiner Oma ins Nachbardorf. Er ist neugierig, was aus Ninas Kürbiskernkopeke auf dem großen Komposthaufen geworden ist.
Schon hat Till die kleinen Kürbisse im Blättergeschling entdeckt. Wie Planeten sehen sie aus.
Bald sind sie so dick wie ein Fußball. Till freut sich über einen besonders großen. Der hat den Umfang eines Wasserballs. Er denkt an Nina. Sie würde staunen über diese Riesenkugel aus Fruchtfleisch. Dabei streicht er über den Kürbisbauch und versucht, ihn ein wenig hin und her zu rollen.
„Der fühlt sich wohl bei mir“, sagt die Oma. „Auf diesem Komposthaufen liegt er gut im Quartier. – Nächste Woche kannst du ihn holen.“
Als Till eine Woche später mit der Oma wieder am Gartentor steht, strahlt ihnen schon von weitem der sonnenrote Kürbis entgegen. Er hat das Pflanzengeschling zur Seite gedrückt. Oma sagt: „Er zeigt sich nun. Jetzt wollen wir ihn ernten.“ „Oh“, sagt Till, „der ist ja ordentlich gewachsen, der ist größer als unser Schulglobus.“
„In alten Zeiten“, erzählt Oma, „wuchs die Kürbispflanze nicht auf der Erde. Sie war wie ein mächtiger Baum. Der ragte so hoch, dass er weit über alle Bäume der Erde hinwegsehen konnte. Ein himmelhoher Baum. Er prahlte, und er lachte über die anderen. Selbst die Wolken ärgerten sich über diesen frechen Kürbisbaum. Darum baten sie den Wind, er möge sich zum Sturm zusammenballen. Der zögerte nicht lange, blies seine Backen auf und schleuderte den Kürbisbaum mit den Früchten zur Erde nieder. Da lag er nun und musste wie eine Schlange auf der Erde kriechen. Seitdem hat er sich nicht wieder erheben können.“
Ein wenig nachdenklich betrachtet Till seinen Kürbis. Er stellt sich vor, dass diese pralle Gartensonne an einem hohen Baum gehangen haben soll. Bei dem Gedanken muss er lachen. „Oma“, sagt er, „stell dir vor, wir beide müssten auf einen so hohen schwankenden Baum klettern, um unseren Kürbis zu holen.“ Auch Oma muss herzlich lachen und sagt, er solle nun seinen Kürbis mitnehmen.“
Reinhard Bernhof ist auch der Autor des 1975 ebenfalls im Kinderbuchverlags Berlin erschienenen und ebenfalls für junge Leserinnen und Leser ab sechs Jahren gedachten Erzählung „Als die Pappel zur Sonne wuchs“: In einer Woche sind die Sommerferien zu Ende und es regnet immer noch. Der Junge wollte so gern baden gehen und die Ferien genießen. Als er die hohe Pappel im Wind schaukeln sieht, klettert er hinauf, immer höher. Weiter hoch als die Flugzeuge und die Satelliten. Er will unbedingt die Sonne bitten, den Regen zu vertreiben. Da kann man schon verstehen, dass der Junge traurig ist und denkt, dass er jetzt endlich irgendetwas unternehmen muss. Aber was?
„Als die Pappel zur Sonne wuchs
Es hatte die ganzen Ferien über geregnet.
Der Junge saß am Fenster, grübelte und wartete auf die Sonne. Wenn sie nur endlich scheinen wollte. Baden möchte er gehen und in die Stadt fahren zum Zoo. Aber die Sonne ließ sich nicht blicken. Sie verbarg sich hinter dunklen Regen- und Gewitterwolken. – Und morgen begann die letzte Ferienwoche.
Immer mehr Regen drosch vom Himmel. Er spülte die Straßen blank und duschte die Bäume im Garten. Der Wind lachte dazu und spielte auf der Harfe des Regens.
Traurig blickte der Junge auf den pitschnassen Hof.
Die Hühner hockten mit aufgeplustertem Federkleid im Holzschuppen und warteten auf die Sonne.
Die Vögel froren in ihren Nestern, und die Bienen konnten nicht ausschwärmen zum Honigflug.
Nur ein paar Enten freuten sich und schnatterten im Schlamm.
Weit hinten, am Ende des Gartens, wo die Felder begannen, bog sich die große Pappel. Sie schien über die Wolken zu ragen. So hoch war sie gewachsen. Vielleicht sah ihr Wipfel die Sonne?
Der Junge hörte den Wind in der Pappel rasen, hörte, wie er an dem Baum hoch- und herunterfuhr.
Er sah, wie die Pappel sich hin und her wiegte, hin und her. Und wie sie sich im Wind wiegte, wuchs sie höher und höher. Weit in die Wolken reichte sie schon, und sie flüsterte mit der Sonne.
„Liebe Sonne“, sagte der Junge, „scheine wieder! Die Birnen und Äpfel, die Weintrauben und Pflaumen brauchen deine Wärme, sonst schmecken sie sauer.“ Aber die Sonne hörte ihn nicht.
Da beschloss der Junge, die Pappel hochzuklettern. Ja, er wollte mit der Sonne sprechen.
Am Anfang war es nicht schwer. Die Pappel nahm den Jungen mit empor. Regen und Wind machten ihm nichts aus. Bald sah er weit über die Häuser hinweg. Ganz nah waren die riesigen Felder. Die Traktoren und Mähdrescher standen still und warteten. Im Regen konnten sie das Getreide nicht ernten. Schwer vor Nässe beugten sich die Halme. „Ich helfe euch!“, rief der Junge, „ich bitte die Sonne, ihre Strahlen zu schicken.“
Aber wie hoch musste er noch klettern, um die Sonne zu erreichen?
Plötzlich kam eine große dunkelgraue Regenwolke angerudert. Als sie den Jungen sah, schwappte sie ihr ganzes Wasser über ihn. Der Junge schüttelte sich wie ein kleiner Hund und schimpfte auf die freche Regenwolke.
„Na warte“, rief er ihr nach, „wenn ich bei der Sonne bin, sage ich ihr, dass sie dich trinken soll.“
Die freche Regenwolke kicherte nur schadenfroh und zog weiter.
Der Junge kletterte schneller, denn seine Kleider waren nass, und er fror.
Allmählich wurde es um ihn herum heller. Die Wolken wurden leichter. Und nun war ringsum Sonne. Sie strahlte und trocknete dem Jungen die Kleider. Unter ihm trieben die dunklen Wolken. Wer sie von hier oben sah, ahnte nicht, dass sie so viel Nässe, so viel Kälte mitschleppten.
Aber noch war die Sonne weit. Der Junge kletterte, und sein Atem wurde schneller. Als er ein Dröhnen in den Ohren spürte, hörte er auf zu klettern. Er hatte die Bahn der Flugzeuge erreicht, eine silbern glänzende Maschine schwebte heran.
Die beiden Piloten winkten dem Jungen zu.
Sie flogen dicht an ihm vorbei, und der eine rief: „Willst du mit? Wir fliegen nach Afrika. Da scheint die Sonne fast immer. Und du kannst baden, wann du willst.“
Der zweite rief: „Auch gibt es langbeinige Vögel dort, Elefanten, Giraffen, bunte Papageien und Nilpferde in den Flüssen.“
„Nein“, rief der Junge zurück, „ich muss die Sonne bitten zu scheinen. Es regnet zu lange bei uns.“
Aus den kleinen runden Fenstern des Flugzeugs winkten Menschen aus aller Welt Der Junge sah zwei lachende Afrikaner, die freuten sich, weil sie nach Hause flogen. Er sah einen Koreaner und einen Inder mit einem märchenhaften Turban. Der Junge winkte zurück, und schon war das Flugzeug vorbei.
Er kletterte weiter und weiter beim leichten Schwanken der Pappel. Über ihm der Himmel mit seinem unendlichen Blau. Darunter die Erde mit ihren Inseln und Kontinenten, das Land mit den gelben Küsten, den braunen Feldern und grünen Wäldern, zum Teil von großen Wolkenfeldern verdeckt. Um das Land herum das weite tiefblaue Meer. Auf ihm wie ausgestreute Metallsplitter die großen Schiffe. Aber unter dem Jungen brauten noch immer die dicken Nebelschwaden, und der Junge überlegte, wo wohl sein Haus stand.
Auf einmal hörte der Junge Funksignale, ganz fein und zirpend. Er sah kleine Punkte auf sich zukommen. Als sie näher kamen, sah er: Es waren tanzende Sputniks. Wie oft hatte er die Signale mit seinen Freunden im Radio gehört, und sie hatten sich vorgenommen, auch Sputniks zu bauen.
Doch jetzt musste der Junge weiterklettern zur Sonne.
Er zog sich höher von Ast zu Ast. Die Arme taten ihm weh. Er wurde müde.
Als er etwas ausruhte, entdeckte er die Kosmonauten. Sie schwebten an einer Leine neben ihrem Raumschiff. In der Hand hielten sie Werkzeuge, mit denen sie die Antennen überprüften.
Sie winkten und riefen: „Hallo, was machst du hier im Weltall, Junge?“
„Ich will zur Sonne klettern und ihr sagen, dass sie wieder scheinen soll, denn es regnet schon die ganzen Ferien über bei uns zu Hause!“
„Wir wünschen dir viel Erfolg!“, riefen die Kosmonauten.“
Ob es der Junge tatsächlich schafft, mit der Sonne ins Gespräch zu kommen und am Ende den Regen zu vertreiben? Das muss man schon selber lesen, aber schon vorher kann man sich über den originellen Einfall des Autors freuen. Wer kommt schon so einfach ins Weltall …
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen und hoffentlich bald etwas wärmeren April, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.
Ach, und um noch einmal auf den aktuellen Monat, auf den April, zurückzukommen, der angeblich immer nicht weiß, was er will. In einer Hinsicht ist in diesem Jahr alles klar: der April 2023 ist Buchmesse-Monat, Leipziger-Buchmesse-Monat, die am 26. April dieses Jahres in der Stadt an der Pleiße offiziell eröffnet wird. Und am nächsten Nachmittag, am 27. April 2023, wird in der Glashalle des Leipziger Messegeländer der Preis der Leipziger Buchmesse 2023 verliehen. Für diese begehrte Auszeichnung hatte die Jury in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung 15 Buchtitel nominiert, darunter „Die Verwandelten“ von Ulrike Draesner und „Aufklärung. Ein Roman“ von Angela Steidele im Sektor Belletristik sowie „Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey und „Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur“ von Jan Philipp Reemtsma.
Die Preisverleihung findet endlich wieder vor den Augen des Messepublikums statt, wird aber auch auf der Website der Leipziger Buchmesse live gestreamt. Selbst wenn Sie nicht in Leipzig sein können, können Sie trotzdem dabei sein …
Schauen Sie doch einfach mal rein – in den Livestream wie anschließend in die nominierten und in die letztlich ausgezeichneten Bücher, aber natürlich auch in die Sonderangebote dieses Newsletters aus dem Hause EDITION digital.
EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.200 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()